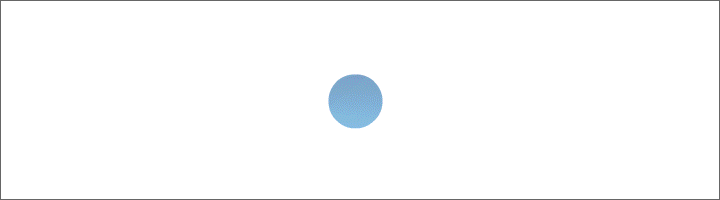Wenn mich bleierne Müdigkeit überkommt, Gedanken sich nur noch schwer ordnen lassen, dann ahne ich: Es ist wieder soweit, die nächste Migräneattacke steht bevor, der Körper schickt bereits seine Botenstoffe aus. Ich kann nichts dagegen tun, nur hoffen, dass alles binnen vierundzwanzig Stunden ausgestanden sein wird. Doch so war es nicht. Drei Nächte und zwei Tage lang hält der brutale Schmerz mich im eisernen Griff. Er leert mir den ohnehin nicht gefüllten Magen, presst meinen Kopf in einen sich permanent weiter zuquetschenden Schraubstock. Ich möchte schreien, klagen. Und bleibe doch stumm. Tränen rinnen aus den Augen, die brennen, als würden sie gekocht. Der Schlaf bringt erschöpfte Pause auf wenige Stunden. Um den Foltertanz erneut anzupeitschen, wenn er verliert gegen die Hölle im Kopf...
Zwei Tage und drei Nächte sind von meinem Leben verloren, als ich heute erwache. Mit Kopfschmerzen und einem Gefühl im Nacken, als habe der Scharfrichter sein Henkerswerk nicht gänzlich vollbracht, wie man es von ihm erwarten konnte. Das Beil steckt noch fest im Nacken, Schultern und Arme scheinen ge- lähmt zu sein vom Schmerz, der sie erfasst hat. Aufstehen. Erbrechen. Tee. Erbrechen. Anziehen. Sonne. Es geht. Was geht? Zu leben.
Ein seltsamer Traum war das. Aus dem ich aufgeschreckt bin. Ein Konstrukt des Unterbewußtseins, na klar. Aus dem ich etwas lernen könnte. Oder verstehen. Nicht nötig. Ich wusste es schon! Ich bin an einem Wen- depunkt angelangt. Entweder - oder. Ich kann mich hinlegen und auf den Tod warten. Oder mich aufrap- peln und kämpfen. Was mir wesentlich mehr liegt. Leben ist nichts für Feiglinge. Dem Sensenmann frei- willig auf die Schippe zu hüpfen, aber garantiert noch weniger!
Im Traum finde ich mich auf einem breiten und schnell dahinströmenden Fluss wieder. Das Kanu besteht aus Baumrinden, ist flach und breit. Wo befinde ich mich? Der Sambesi kommt mir in den Sinn (David Li- vingstone hat mich schon als Kind fasziniert)! Womit ich gleichzeitig an die Victoriafälle denke. Kann ich nicht zur Abwechslung mal etwas Nettes träumen? Höre ich tiefes Donnergrollen in der Ferne? Angestrengt lausche ich. Nein! Ich treibe nur rasch dahin, kaum vermag ich die Tiere um ich her und das Geschehen am Ufer zu erfassen.
Noch schwanke ich zwischen den Gefühlen von Abenteuer und Aufregung. Als plötzlich Georg neben mir sitzt. Völlig aufgelöst und verzweifelt. "Wir haben keine Ruder, nicht einmal Paddel!" Stimmt. Jetzt bemerke ich es auch. "Aber mit unseren Armen können wir auch steuern, wir schaffen das!" Er weint, ich streiche ihm voller Liebe zärtlich die Haare aus der Stirn. "Wein' doch bitte nicht, ich bekomm' das hin!" Während ich das noch flüstere ist er fort und ich bin allein. Wie damals.
Die Wasser verjüngen sich, werden schmaler und flacher. Irgendwann setzt das Kanu auf. Erstaunt steige ich aus. Folge dem Wasserlauf zu Fuß. Bis er ganz versiegt. Um mich her ist alles öde und trocken, nir- gendwo noch ein Tropfen in Sicht. Ganz gleich in welche Richtung ich auch gehe, den Fluss finde ich nicht wieder. Er ist versiegt. Einfach so. Wasser ist Leben, so denke ich. Und Worte sind es auch. Damit schrecke ich hoch.
Aus der Migräne sind Kopfschmerzen geworden. Den Traum verstehe ich sehr wohl.
Ein Strom vermag zu versickern. Ein Kanu strandet, wenn Paddel und Ruder fehlen.
Aber man kann zu Fuß weitergehen! Es gibt immer eine Chance. Wenn man nur daran glaubt.
Ach, mein Liebster, hättest Du doch nur auch dieses Vertrauen gehabt...