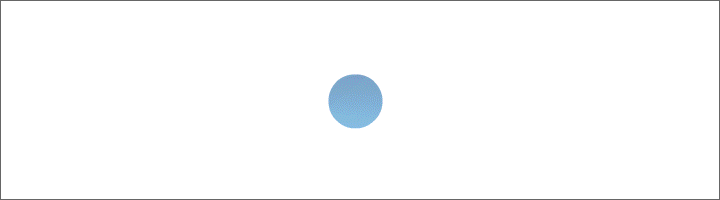Menschen leben. Und sterben. Das wissen wir oft schon als Kinder.
Wenn wir Angehörige verlieren. Vielleicht auch nur unseren Hamster.
Wie soll man begreifen, dass ein Wesen, das man liebte,
sich nun an einem so seltsamen, entfernten Ort wie dem Himmel,
der bei Tieren auch wahlweise
Katzen-, Hunde- oder Hamsterhimmel heißen kann, befinden soll.
Ist es dort warm, oder kalt? Still, oder laut?
Findet man Gesellschaft, Versorgung, gar Liebe vor?
Können uns Oma, Opa oder unser Lieblingstier von dort sehen?
Oder gar auf der Erde begleiten, beschützen, uns erwarten?
Wir wissen es nicht. Niemand kam je zurück.
Also bleibt uns nur zu glauben. Je nach Einstellung.
An alles, was ein Individuum so als tröstlich empfindet.
An jenes, was uns andere Menschen vorleben.
An das, was uns im Laufe der Zeit zur Überzeugung wird.
Manche lehnen alles ab. Nur Humbug. Sind sie besser dran?
Übler? Fällt es ihnen schwerer, oder gar leichter „zu gehen“?
Wohin überhaupt? Ist nicht manchmal eben das „Nirwana“ das Ziel?
Ich lese gerade weiter im Buch von Eric Wrede: THE END.
Bei weitem nicht so locker, wie ich es zuvor dachte.
Zehn Jahre eher wäre ich vermutlich entspannter dabei gewesen.
Und vor dreißig Jahren wohl (kurz) noch mehr.
Mein Kaufmannshaus hatte ich gerade gekauft.
Geräumig. In einer Seehafenstadt gelegen. Touristenort.
Alle Schalter waren auf „Freie Fahrt voraus“ gestellt.
Der Tod schien unendlich weit fort zu sein.
Und trat doch so unfassbar rasch zwischen die Mauern.
Damals begriff ich im Zeitraffer, wie kurz das Leben sein kann.
Auch und gerade das eines Kindes.
Zwei Jahre später stand ich an den Betten vieler Erwachsener.
Begleitete sie beruflich, bis sie fortgingen. Ohne Widerkehr.
Es wurde zu meinem Alltag. Nicht zur Ausnahme.
Als mir klar wurde wie ausgebrannt ich davon war,
brach meine so starke Scheinwelt zusammen.
Weit weg wollte ich von da ab sein. Von Sterbebetten.
Beerdigungen. Friedhöfen. Abschieden. Trauer.
Verdrängte ich? Oder war es eine heilende Befreiung?
Jedenfalls lebte ich. Der Tod spielte keine Rolle mehr.
Erst einige Jahre später holte mich der Gedanke an ihn ein.
Auf meinen vier Caminos nach Santiago.
Immer wieder stand ich vor Erinnerungssteinen am Wegesrand.
Von Pilgern, die auf ihrem Jakobsweg gestorben waren.
Einige verschwanden auch spurlos. Andere wurden ermordet.
An Bäumen, in Mauernischen, Grotten, oder Kirchen
klebten, lagen, hingen zudem viele Zettelchen und Fotos.
Mit flehentlichen Bitten um Gebete, Gedanken.
Für todkranke Menschen, oft genug Kinder.
Das berührt mich tief, man kann nicht darüber hinwegsehen.
Und sollte es auch nicht. Wenn man pilgert und nicht wandert.
Auf meinem letzten Weg 2013 geriet ich selbst in Gefahr.
Und dachte in diesem Moment sehr intensiv über den Tod nach.
Würde man mich an einsamer Stelle in den Bergen finden?
Dass ich mit einer Fraktur nicht zurück kriechen konnte war auch klar.
Aber meine Zeit war offenbar noch nicht gekommen.
Der Tod geriet dank Guardia Civil erneut in den Hintergrund.
Ganz andere Sorgen belasteten mich.
Wühlten sich in meine Gedanken.
„Kränkten“ mich, im allerwahrsten Sinne des Wortes.
Und nun?
Da alles jederzeit eintreten kann, wie denke ich da?
Ich habe mich vorbereitet, in vielerlei Hinsicht.
Vielleicht so distanziert, als ginge es dabei gar nicht um mich.
Vermutlich geht das aber irgendwie auch gar nicht anders.
Sonst kann man sich gleich ins Bett legen und sterben.
Aber damit würde man sich selbst um Zeit betrügen.
Die man vielleicht noch hat. Und deren Dauer man nicht kennt.
Trotzdem sollte man nichts verleugnen, sich stellen.
Auch wenn das nicht leicht ist. Wir sterben alle. Irgendwann.
Durch die Liebe werden wir zu Poeten,
die Annäherung an den Tod macht uns zu Philosophen.
JORGE SANTAYANA